Testierfähigkeit und Testierunfähigkeit im Erbrecht
Hier erhalten Sie von uns Infos zu Fragen einer für die Errichtung einer wirksamen letztwilligen Verfügung notwendigen Testierfähigkeit oder einer möglicherweise bestehenden Testierunfähigkeit und erläutern Ihnen die hieraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen.
Alles zur Testierfähigkeit bei der Testierung
Inhalt zu den Infos
1. Abgrenzung der Testierfähigkeit von Geschäftsfähigkeit
2. Auswirkungen der Testierunfähigkeit auf Testamente
3. Auswirkungen der Geschäftsunfähigkeit auf Erbverträge
4. Arten der Demenz und ihre Auswirkungen auf die Testierfähigkeit
5. Verfahren bei Zweifeln an der Testierfähigkeit im Erbfall
Abgrenzung der Testierfähigkeit von Geschäftsfähigkeit
Ein wirksames Testament kann nur errichten, wer bei der Errichtung noch testierfähig ist. Im Gegensatz zum Testament kommt es zur Wirksamkeit eines Erbvertrags hingegen nicht auf die Testierfähigkeit an, sondern es muss noch eine Geschäftsfähigkeit der Vertragsschließenden vorgelegen haben.
Gem. § 2229 Abs.4 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist nicht mehr testierfähig, wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Der Testierende muss also zur Testierfähigkeit noch in der Lage sein, den Inhalt der von ihm errichteten letztwilligen Verfügung zu erfassen und sich über die damit verbundenen persönlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die jeweils Bedachten ein Bild machen können. Die Testierfähigkeit ist ein Sonderfall der Geschäftsfähigkeit.
Gem. § 2229 Abs.1, Abs.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kann ein Minderjähriger ein Testament erst dann errichten, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat, ohne dass der zur Errichtung eines Testaments der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf; allerdings kann er ein Testament gem. § 2233 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur durch eine Erklärung gegenüber dem Notar oder durch Übergabe einer offenen Schrift an den Notar in wirksamer Weise errichten, ohne dass für ihn somit die Möglichkeit besteht, ein privatschriftliches Testament i.S.v. § 2247 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) durch eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung zu errichten.
Geschäftsunfähig ist hingegen gem. § 104 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat oder wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.
Auswirkungen der Testierunfähigkeit auf Testamente
Ein Testament eines bei dessen Errichtung testierunfähigen Erblassers ist nichtig, also unwirksam. Die Unwirksamkeit des Testaments wird auch bei einem späteren
Wiedereintritt der Testierfähigkeit nicht beseitigt; in diesen Fällen muss das Testament vom Erblasser gem. § 141 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in formgerechter Weise nochmals neu errichtet
werden.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Testierfähigkeit oder Testierunfähigkeit ist ausschließlich der Zeitpunkt der Errichtung des Testaments. Nur vorübergehende Störungen der
Geistestätigkeit zu diesem Zeitpunkt bleiben in der Regel ohne Auswirkung auf die Testierfähigkeit, wenn die freie Entschlussfähigkeit zumindest zeitweise vorhanden ist und der Testierende die
Tragweise des Testaments noch zu erkennen vermag.
Auswirkungen der Geschäftsunfähigkeit auf Erbverträge
Voraussetzung für den wirksamen Abschluss eines Erbvertrags ist gem. § 2275 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), dass der Erblasser hierbei noch unbeschränkt geschäftsfähig ist, somit reicht hierfür eine lediglich noch
bestehende Testierfähigkeit nicht aus. Ein Erbvertrag einer hierin letztwillig verfügenden Person, die nicht mehr geschäftsfähig, also geschäftsunfähig oder in ihrer
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, stellt sich als unwirksam und damit als nichtig dar. Mithin kann ein Geschäftsunfähiger oder beschränkt Geschäftsfähiger einen Erbvertrag nicht in wirksamen
Weise schließen.
Zwar bedarf ein Erbvertrag zur Formwirksamkeit grundsätzlich einer notariellen Beurkundung. Der hierin regelmäßig beinhalteten Angabe, dass sich der beurkundende Notar von der noch
fortbestehenden Geschäftsfähigkeit und Testierfähigkeit der Vertragsschließenden durch geeignete Nachfrage überzeugt hat, kommt grundsätzlich jedoch keine ausreichende Bedeutung, insbesondere
kein hinreichender Beweiswert zu. Ein Notar kann nämlich nach der obergerichtlichen Rechtsprechung nicht zweifelsfrei beurteilen, ob eine Person wirklich noch in dem
erforderlichen Umfang geschäftsfähig ist, da ein Notar als Jurist nicht über das notwendige medizinische Fachwissen und die fachliche Qualifikation hierfür verfügt (vgl. OLG Hamm, Urteil vom
13.07.2021, Az.: 10 U 5/20).
Arten der Demenz und ihre Auswirkungen auf die Testierfähigkeit
Die (fortgeschrittene) Demenzerkrankung eines Testierenden führt nicht grundsätzlich unter Aufhebung der Testierfähigkeit zu einer Testierunfähigkeit, kann aber die Annahme einer
Testierunfähigkeit dann begründen, wenn der Testierende krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist, die Bedeutung und die Tragweite einer erklärten letztwilligen Verfügung einzusehen und nach
einer solchen Einsicht zu handeln. Entscheidend ist insoweit stets sowohl die Art, als auch das Ausmaß der Demenerkrankung und darüber hinaus auch ihre individuelle Auswirkung auf den
Erblasser.
Bei altersbedingten Störungen der Geistestätigkeit, welche häufig unter den Begriff „Demenz“ subsumiert werden, wird zwischen einer Vielzahl von unterschiedlichen Demenzformen, z.B.
arterio-sklerotischer Demenz, generativer Demenz, vaskulärer Demenz, Kreuzfeld-Jakob-Demenz, Alzheimer-Demenz, frontotemporaler Demenz, Multiinfarkt-Demenzen und Parkinson-Syndromen,
unterschieden.
Eine Demenzerkrankung in jeder der unterschiedlichen Demenzformen entwickelt sich in der Regel zeitlich abgestuft über mehrere Stufen. Bei den verschiedenen Stufen von Demenzerkrankungen wird
zwischen leichter Demenz, mittelschwerer Demenz und schwerer Demenz unterschieden.
Ein nur an leichter Demenz erkrankter Erblasser kann durchaus noch in der Lage sein, sich ein Urteil über die Tragweite und Bedeutung einer in einem Testament zu treffenden Verfügung von Todes
wegen zu bilden. Bei einer nur an leichtgradigen Demenz erkrankten Person wird dies sogar regelmäßig noch der Fall sein, wonach in diesen Fällen von einer noch bestehenden Testierfähigkeit in der
Regel ausgegangen werden kann.
Ab einem mittelschweren und bei einem schweren Grad einer Demenzerkrankung wird hingegen in der Regel vom Vorliegen einer Testierunfähigkeit ausgegangen werden müssen, wonach eine
Testierfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Allerdings muss auch in diesen Fällen die Testierunfähigkeit individuell geprüft und notfalls unter Beteiligung von Sachverständigen festgestellt werden.
Verfahren bei Zweifeln an der Testierfähigkeit im Erbfall
Gelangt ein Beteiligter in einer Nachlassangelegenheit nach Eintritt des Erbfalls zu der Auffassung, dass der Erblasser bei Errichtung einer ihn beschwerenden - also für ihn nachteiligen -
letztwilligen Verfügung nicht mehr testierfähig gewesen sein dürfte, eine Testierfähigkeit also nicht mehr vorgelegen hat, empfiehlt es sich, dies dem Nachlassgericht unter
Darlegung sämtlicher hierfür sprechender Anknüpfungstatsachen unverzüglich mitzuteilen und hierzu beispielsweise vorhandene Arztberichte über mit kognitiven oder sonstigen psychischen
Beeinträchtigungen verbundene Erkrankungen des Testierenden vorzulegen. Insoweit empfiehlt sich ferner, hiermit auch die Schilderung von konkreten Tatsachen durch Personen aus dem Nähe-Bereich
des Erblassers über dessen Verwirrtheit zu fraglichen Zeitpunkt zu verbinden.
Wurde im Erbscheinsverfahren die Testierunfähigkeit des Erblassers von einem der Beteiligten in hinreichender Weise eingewendet, wird das Nachlassgericht danach von Amts wegen geeignete
Feststellungen zur Frage der Testierfähigkeit bzw. Testierunfähigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt der Errichtung der für die Erbfolge maßgeblichen letztwilligen Verfügung zu treffen haben. Zur
Frage der Testierunfähigkeit wird insoweit zumeist eine förmliche Beweisaufnahme i.S.v. § 30 Abs.3 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) geboten sein, wonach unter Hinzuziehung eines zu beauftragenden Sachverständigen die Parteien anzuhören und etwaige Zeugen zu
vernehmen sein werden. Danach wird dann eine förmliche Entscheidung des Nachlassgerichts im Erbscheinsverfahren zu ergehen haben.
Beweislast und Feststellungslast für Testierfähigkeit
Grundsätzlich ist eine testiermündige Person zum maßgeblichen Zeitpunkt der Testamentserrichtung so lang als testierfähig zu beurteilen, wie seine Testierunfähigkeit nicht als zweifelsfrei
erwiesen gilt; die Annahme der Testierfähigkeit ist also der Regelfall. Nur bei begründeten Zweifeln an der Testierfähigkeit eines Verstorbenen zum Zeitpunkt der Errichtung einer letztwilligen
Verfügung hat das Nachlassgericht im Zuge seiner Amtsermittlungspflicht gem. § 26 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) von Amts wegen geeignete
Feststellungen zu treffen.
Allerdings liegt die Feststellungslast zur Testierunfähigkeit grundsätzliche bei demjenigen, der sich auf das Nichtbestehen der Testierfähigkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt
beruft. Hierbei darf sich derjenige, der die Testierfähigkeit bestreitet, nicht nur auf bloße Zweifel oder unsubstantiierten Vortrag beschränken, sondern muss seine Behauptungen näher mit
Tatsachen begründen. Kommt er dem in hinreichender Weise nach und liegen hiernach erhebliche Indizien für eine Testierunfähigkeit des Erblassers zum maßgeblichen Zeitpunkt vor, hat das
Nachlassgericht geeignete Beweiserhebungen zu veranlassen.
Bei begründeten Zweifeln an der Testierfähigkeit, also bei konkreten Anhaltspunkten für eine Testierunfähigkeit, wird das Nachlassgericht neben der Vernehmung von Zeugen, insbesondere der
Anhörung der den Erblasser zuletzt behandelnden Ärzte, in der Regeln dann ein Sachverständigengutachten eines Sachverständigen für Neurologie, Psychiatrie oder Rechtsmedizin einholen.
Rechtsfolgen bei Feststellung der Testierunfähigkeit
Kommt das Nachlassgericht nach regelmäßig durchzuführenden Beweiserhebungen zu der Überzeugung und Feststellung, dass der Erblasser eine letztwillige Verfügung zu einem Zeitpunkt errichtet hat, als er nicht mehr testierfähig gewesen ist, eine Testierfähigkeit also nicht mehr bestanden hat, hat das Nachlassgericht den Antrag auf Erteilung eines Erbscheins eines Beteiligten, welcher sein Erbrecht aus der vom Erblasser im Zustand der festgestellten Testierunfähigkeit errichteten letztwilligen Verfügung ableitet, zurückzuweisen.
Nicht behebbare Zweifel an der Testierfähigkeit
Für den Fall, dass nach und trotz Ausschöpfung aller Aufklärungsmöglichkeiten nicht behebbare Zweifel des Nachlassgerichts verbleiben, ob der Erblasser bei der Testamentserrichtung testierfähig gewesen ist oder nicht, sich die Frage der Testierfähigkeit oder Testierunfähigkeit also nicht abschließend zur hinreichenden Gewissheit des Nachlassgerichtes aufklären lässt, muss das Nachlassgericht von einer Testierfähigkeit des Erblassers zum maßgeblichen Zeitpunkt zu Lasten desjenigen ausgehen, der sich auf die Testierunfähigkeit beruft.
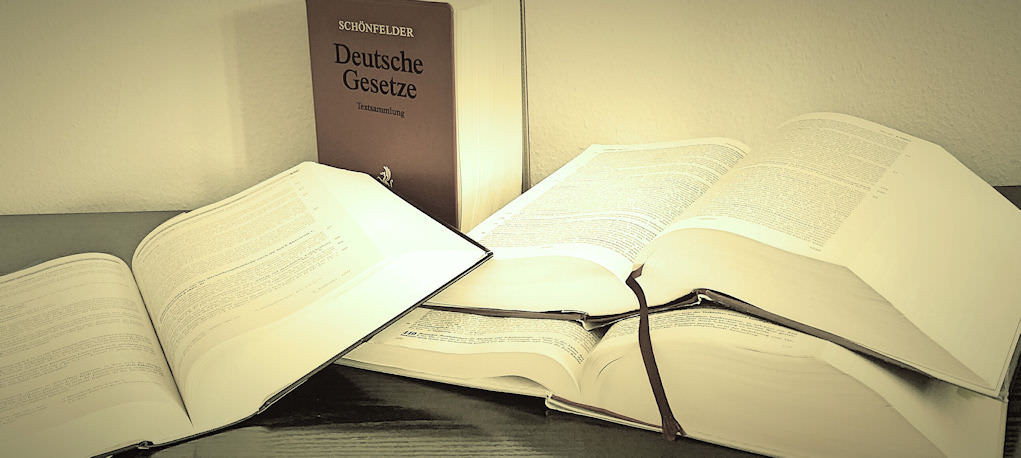 Anwaltskanzlei Denzinger & Coll.
Anwaltskanzlei Denzinger & Coll.Ihr Rechtsanwalt in Augsburg
86150 Augsburg
Bayern DE
Telefon: +49 (0)821 510747
Telefax: +49 (0)821 510700
E-Mail: ra.denzinger@t-online.de
48.368217 10.892099

Beiträge aus dem Blog:
-
26.05.2022 Neue Kammer für Erbsachen
- 01.08.2018 beA geht wieder online
- 25.05.2018 Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- 15.04.2018 Rechtsanwalt Rainer Denzinger im TV
- 18.12.2015 Massenentlassung bei ALSO
- 08.10.2015 Einsatz verdeckter Ermittler
- 11.09.2015 Pilotenstreik untersagt
- 21.08.2015 EU-ErbRVO regelt neues Erbrecht
Bewertungen von Rechtsanwalt Rainer Denzinger unter anwalt.de
Rezensionen von Anwaltskanzlei Denzinger & Coll. unter Google
Gesamte Bewertungen ★★★★★ (sehr gut) 4,7 von 5 Sternen bei 89 Rezensionen insgesamt
Folgen und besuchen auf:
Seite empfehlen und teilen mit:
Inhalt von Seiten durchsuchen:
Gesamte Website durchsuchen:
© 2025 Anwaltskanzlei Denzinger & Coll. - Ihr Rechtsanwalt und Fachanwalt in Augsburg



